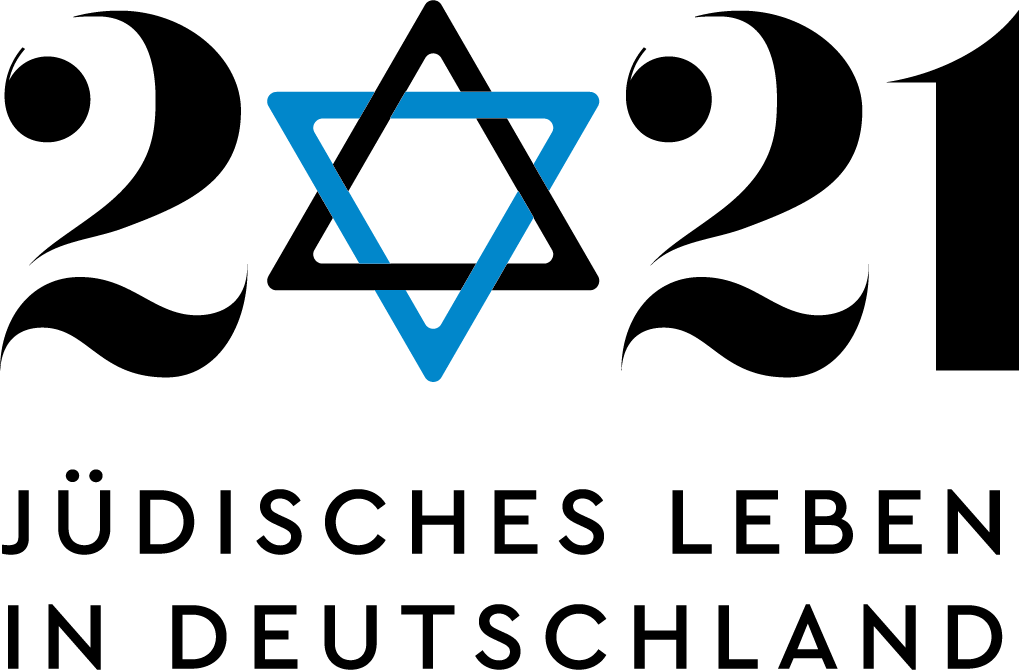Eine Fahrt nach Auschwitz

In diesem Sommer reiste die Dülmener Pastoralreferentin Ursula Benneker-Altebockwinkel zum ersten Mal nach Polen. An einem Tag besuchte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann das frühere Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz (Oswiecim). Wir haben sie über ihre Eindrücke befragt.
Wann und mit welcher Motivation entstand die Idee, einmal die Gedenkstätte Ausschwitz zu besuchen?
Jedes Jahr, am 27. Januar, begehen wir in Deutschland den „Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“. Es ist der Tag, an dem 1945 die Gefangenen im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von der Roten Armee befreit wurden.
In diesem Jahr hatte ich aus Anlass dieses Gedenktages ein Buch mit dem Titel „Solange wir leben, müssen wir uns entscheiden. – Leben nach Auschwitz“ gelesen. In dem Buch interviewt der Psychiater und Theologe Manfred Lütz den Auschwitz-Überlebenden Jehuda Bacon, dem er in Jerusalem begegnet ist. Das Buch bringt die Lebensgeschichte eines Menschen zur Sprache, der Entsetzliches erlebt hat und trotzdem daran nicht zerbrochen ist. Nachdem ich das Buch gelesen hatte, wollte ich selbst einmal das Konzentrationslager besuchen. Deshalb planten wir unseren Urlaub für diesen Sommer in Polen.
Wie muss man sich den Besuch in Auschwitz vorstellen bzw. was sollte man bei der Planung eines solchen Besuchs beachten?
In den Wochen vor unserem Polen-Besuch haben wir uns mit dem Nationalsozialismus in Deutschland erneut auseinandergesetzt.
Wir haben viel über den Holocaust und über Auschwitz gelesen.
Mein Mann hatte im Jahr 1989 im Rahmen einer Jugendbildungsfahrt bereits eine Führung mit einem KZ-Überlebenden durch das Lager miterlebt - mir war ein Besuch dort bislang nicht möglich gewesen.
Als wir dann in Polen waren, haben wir uns für eine 6-stündige Führung in deutscher Sprache angemeldet. In unserer Gruppe waren insgesamt 15 Personen, darunter zwei Jugendliche aus Höxter.
Welche Eindrücke und Empfindungen des Besuchs der Gedenkstätte sind besonders nachhaltig in Erinnerung?
Der Gang durch die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau hat mich erschüttert und hat wieder einmal die Frage in mir zurückgelassen, wie das alles passieren konnte.
Der Raum, in dem an weiß gestrichenen Wänden die Zeichnungen von jüdischen Kindern angebracht waren, die während ihres Aufenthaltes in Auschwitz angefertigt wurden, hat mich lange beeindruckt.
Diese Skizzen und Bilder drücken auf eindrucksvolle Weise aus, welche Ängste die Kinder ausgestanden haben, aber auch, welche Sehnsüchte
in ihnen lebendig waren, nach einem Leben, wie sie es vor der Deportation in ihren Familien kennengelernt hatten.
In einem weiteren Raum haben mich die auf unzähligen Buchseiten eingetragenen Namen von vier Millionen Juden beeindruckt, die während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland ermordet wurden, davon allein ca. eine Million Juden in Auschwitz.
Ihren Besuch in Auschwitz haben Sie mit einem besonderen „Auftrag“ verbunden: Können Sie in der gebotenen Diskretion darüber berichten?
Als wir am Montag, dem 1. Juli 2024, morgens um 8.00 Uhr nach Auschwitz aufgebrochen sind, hatte ich ein Stückchen Ziegelstein in meiner Hosentasche. Ich hatte es kurz vor unserer Abreise nach Polen von einem Priester bekommen. Er selbst war vor 25 Jahren in Auschwitz gewesen und hatte dort, am sog. „Weißen Haus“, diesen Ziegelsplitter aufgehoben und mit nach Deutschland genommen.
Er tat es in Erinnerung und im Gedenken an die heilige Edith Stein, die am 9. August 1942 an diesem Ort vergast und ermordet worden ist.
Der Priester bat mich vor unserer Polen-Reise, die Tonfliese
mit nach Auschwitz zu nehmen und sie an dem Ort, von wo er sie einst mitgenommen hatte, wieder abzulegen.
Diesen Gefallen wollte ich ihm gerne tun und so habe ich im Gedenken an Edith Stein und an die vielen Menschen, die in Birkenau zu Tode gekommen sind, die Tonscherbe am „weißen Haus“ wieder zurückgelegt und sie mit einer Blume geschmückt, die ich direkt neben den Resten der ehemaligen Verbrennungsanlage, also an dem Ort, wo einst der Tod das Sagen hatte, auf einer bunten Blumenwiese gepflückt hatte.
Ich dachte dabei an Edith Stein, die einmal gesagt hat:
„Ich glaube, die Unfähigkeit, dem Zusammenbruch der äußeren Existenz ins Auge zu sehen und ihn auf sich zu nehmen, hängt mit dem mangelnden Ausblick auf ein ewiges Leben zusammen: Das ganze Streben eines Menschen ist nur ein Diesseitiges.“
(Edith Stein, geb. am 12. Oktober 1891 in Breslau, ermordet am 9. August 1942 in Birkenau)
Ich hoffe, dass Edith Stein in ihrer größten Not, in der sie angesichts ihres bevorstehenden Todes in Auschwitz-Birkenau gestanden hat, diesen „Ausblick auf ein ewiges Leben“ in sich getragen hat!
Fotos: Torhaus in Auschwitz: wikipedia.org#Jason M Ramos - Auschwitz, CC BY 2.0; alle weiteren privat