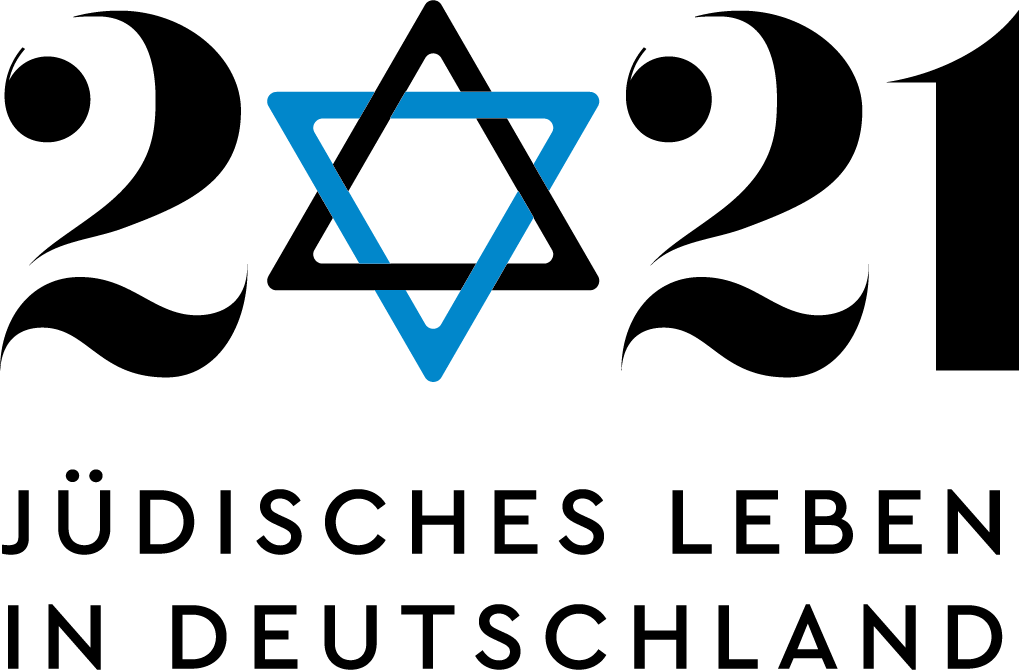Digitales Findbuch zu NS-Verbrechen

Ein „digitaler Atlas“ wurde am 9. Dezember in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. Er soll im kommenden Jahr, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, die vielen Tausend Tatorte von NS-Verbrechen in Deutschland in Erinnerung rufen. Dieser Online-Atlas wird von der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ verantwortet und vom Bundesfinanzministerium mit bis zu 780.000 Euro gefördert. Die entsprechende App sei nach Auskunft von Projektleiter Wolfgang Hauck voraussichtlich ab Februar verfügbar. In dem digitalen Findbuch sind auf Landkarten rund 25.000 Fälle verzeichnet, die sich auf rund 8.000 Orte in ganz Deutschland beziehen. Grundlage ist eine von Historikern zusammen getragenen Datenbank mit Gerichtsakten zu Fällen, die nach 1945 abgeurteilt wurden. Diese Informationen würden, so Hauck gegenüber der Deutschen Presseagentur, „niedrigschwellig“ für alle Interessierten zugänglich gemacht, statt nur für Wissenschaftler in Archiven. Der Fokus liege auf jungen Leuten. Wer im eigenen Ort weiter recherchieren wolle, könne von den Projektverantwortlichen weitere Erkenntnisse anfragen. „Es ist nicht innovativ“, meint Hauck. „Es ist die Herstellung einer Selbstverständlichkeit.“ Der Anstoß zur Recherche der Fälle bundesweit sei schon vor Jahren von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem gekommen. Diese habe in Deutschland nach einer Übersicht der von Gerichten verfolgten Verbrechen gefragt, die aber zum damaligen Zeitpunkt nicht vorgelegen habe. Die Verbrechen, die der Digitalatlas zusammenstellt, lassen sich in „Tatkomplexe“ gliedern – wie beispielsweise Pogrom, Denunziationen, Verbrechen an politischen Gegnern, Endphasenverbrechen oder sogenannte Euthanasie. „Das Erschreckende an diesem Projekt ist die Bandbreite“, sagte Wolfgang Hauck.