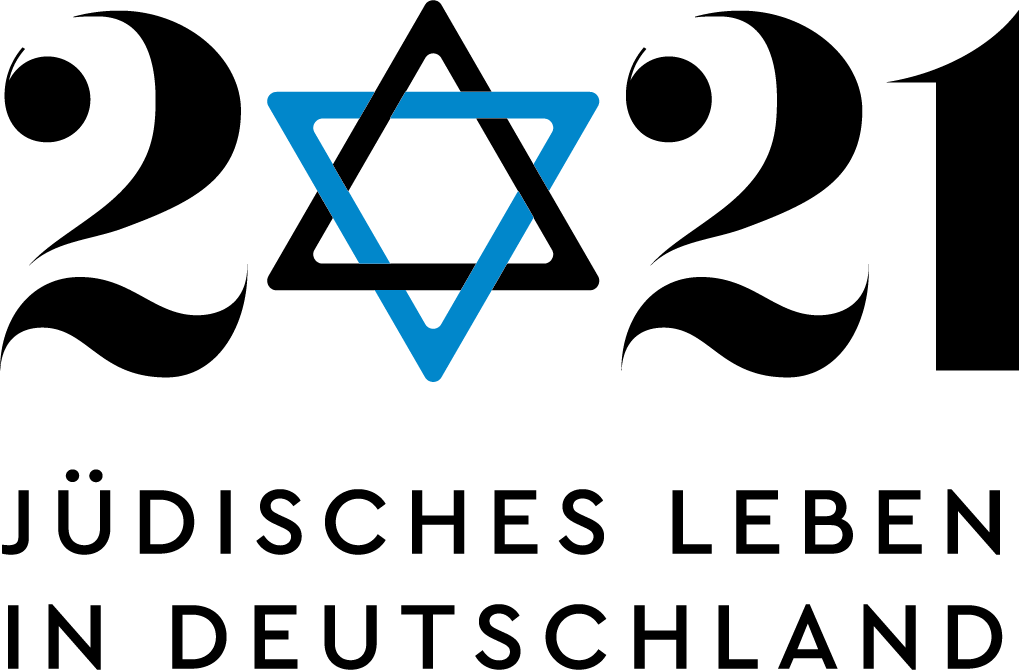Jüdisches Gedenken beim Volkstrauertag
Seit einigen Jahren beteiligt sich beim jährlichen Gedenkakt zum Volkstrauertag auf der niederländischen Kriegsgräberstätte Ysselsteyn auch ein Vertreter der jüdischen Gemeinschaft. Dass auch in diesem Jahr (2025) neben Vertretern aus Politik und Gesellschaft ein jüdischer Rabbiner am Gedenkakt in Ysselsteyn teilnahm, geht auf eine Kontroverse im Jahre 2020 zurück. „Stoppt den deutschen Gedenktag in Ysselsteyn“, forderte damals Oberrabbiner Binyomin Jacobs in einer Kolumne am 13. Oktober 2020 in der „New Israelite Weekly“ (NIW), da es „zu viele Kriegsverbrecher“ auf dieser größten deutschen Auslandskriegsgräberstätte gebe. Der Friedhof Ysselsteyn, so Jacobs, sei „eine Ansammlung von SS-Schergen, holländischen SD-Männern, Kollaborateuren, von denen einige vom Widerstand erschossen worden waren. Auch die Person, die Anne Frank und ihre Familie deportieren ließ, ist dort begraben.“ Er rief dazu auf, nicht länger „Verrätern und Mördern“ eine Ehrung zuteilwerden zu lassen, „die sich freiwillig dafür entschieden haben, meine Familie zu ermorden oder sie in die Gaskammern zu schicken.“ Verschiedene Informationstafeln weisen heute in Ysselsteyn darauf hin, dass die deutschen Kriegshandlungen in den Niederlanden auch ein Teil des Unterdrückungs- und Verfolgungsapparates gegenüber der jüdischen Bevölkerung waren.
In diesem Jahr war es der niederländische Militär-Rabbiner („Krijgsmachtrabbijn“) David Gaillard, der die schwierige Ambivalenz von Schuld und Versöhnung ins Wort brachte. Aus eigenem Erleben schilderte er, wie er als junger Journalist ein Interview mit Prinz Claus von Amsberg führen durfte: Es sei das erste Interview überhaupt gewesen, das der niederländische Prinzgemahl einer Zeitung erlaubt habe. „Gerade weil so viele Niederländer ihn als ‚Deutschen‘ beargwöhnten, wollte er ein Zeichen setzen“, so der Rabbiner. Gaillard wies darauf hin, dass im Judentum insbesondere das Buch der Psalmen helfe, das Herz und den Geist zu weiten – auch, um Schuld anzuerkennen und sich vor Verzweiflung zu wappnen. Er zitierte eine Inschrift an einer Kellerwand in Köln, wo sich während des Krieges der Jude Zvi Kolitz versteckte: „Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt.“
Auf der Kriegsgräberstätte Ysselsteyn liegen auch vier Soldaten aus Dülmen begraben – die allesamt noch in den letzten Kriegsmonaten eingezogen wurden und im Herbst 1944 an der Maas den Tod fanden.