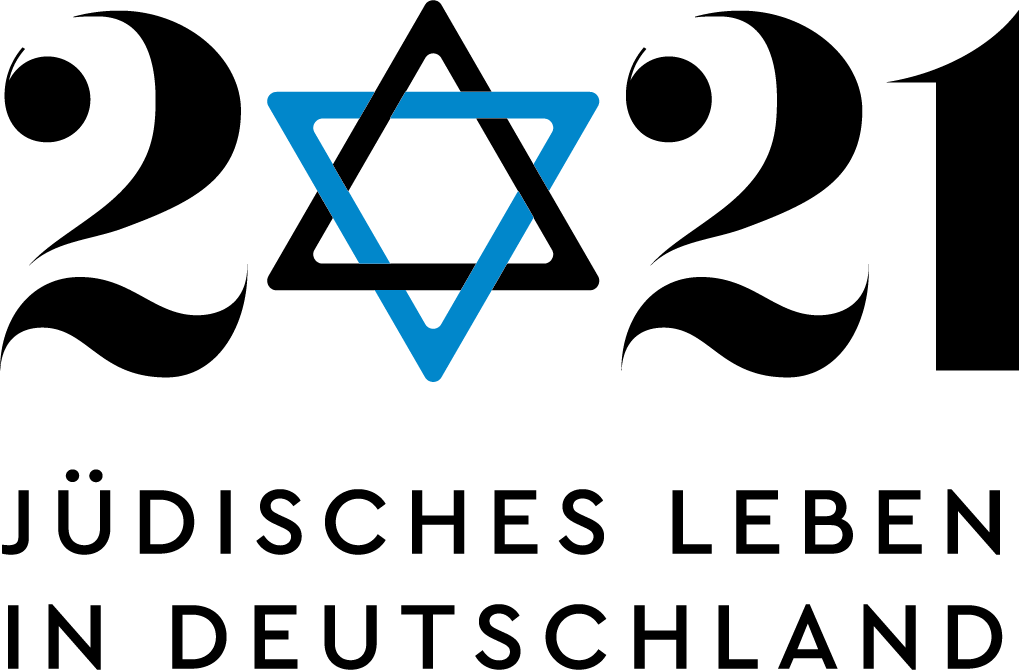Archiv 2024
Historische Öllampe in Israel entdeckt

Archäologen haben in Jerusalem bei Ausgrabungen eine ca. 1700 Jahre alte Öllampe gefunden. Das historische Fundstück aus Keramik ist mit einem Menora-Leuchter sowie anderen jüdischen Symbolen verziert – so eine Auskunft der Israelischen Altertumsbehörde. Während des jüdischen Lichterfests Chanukka, das am Mittwochabend (25.12.) begonnen hat, soll die Lampe bei einer Ausstellung in Jerusalem gezeigt werden.
Die Lampe wurde bei Grabungen auf dem Ölberg in Jerusalem gefunden. Rußspuren weisen, dass das Gefäß vor rund 1700 Jahren tatsächlich auch zur Beleuchtung verwendet wurde. „Die ausgezeichnete künstlerische Verarbeitung der Lampe, die vollkommen heil gefunden wurde, macht sie zu einem außergewöhnlichen und extrem seltenen Fund“, erklärt der Archäologe Michael Chernin. An Chanukka (hebräisch: „Einweihung“) erinnern sich die Juden an die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels – nachdem sich jüdische Kämpfer im Jahre 165 v. Chr. unter Führung der Makkabäer-Familie erfolgreich gegen die syrisch-griechische Fremdherrschaft aufgelehnt hatten.
Der Menora-Leuchter lebt in der christlichen Kunst fort, so auch in Dülmen und Umgebung. In der Publikation „Im Bündel des Lebens“ (Dülmen 2021) wird auf S. 27 >>> die Bedeutung der Menora näher erläutert.
„Keller Pins“ in wissenschaftlichem Aufsatz

„Wie der Meister, so das Werk“ – so lautet der Titel einer Festschrift, die anlässlich des 65. Geburtstages des Tübinger Mittelalter- und Neuzeitarchäologen Dr. Ralph Röber erschienen ist. Die Publikation erschien als Nr. 9 der „Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie“. Darin schildert Dr. Hans-Werner Peine in einem Aufsatz unter dem Titel „Jüdische Kulturspuren“ verschiedene „Ergebnisse archäologischer Suche im Bodenarchiv von Westfalen-Lippe“. Neben verschiedenen Freilegungen von Resten von Synagogen oder Mikwen wird (auf S. 170) auch die Freilegung des Dülmener „Keller Pins“ gewürdigt bzw. (auf S. 172) auf einschlägige Literatur hingewiesen.
Fünf Millionen Dollar für Zehn Gebote

Bei einer Sotheby's-Auktion in New York am 18. Dezember hat eine Steintafel mit den Zehn Geboten eine Millionensumme erzielt. Die Marmortafel mit den in althebräischer Schrift eingemeißelten Zehn Geboten ist etwa 50 Kilogramm schwer und rd. 60 Zentimeter hoch. Eine historische Einordnung ist schwierig; seitens des Auktionshauses wurde ihr Alter wird auf 1.500 Jahre geschätzt. Die Inschrift ist ungewöhnlich: Zwar lehnen sich die 20 Textzeilen eng an den biblischen Text des Buches Exodus an, doch fehlt das Gebot „Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen“. Dieses Gebote wurde durch ein anderes Gebot ergänzt: Man solle Gott am Berg Garizim verehren, dem zentralen heiligen Ort der Samaritaner. Lange Zeit ist die Bedeutung des Fundes nicht erkannt worden. 1913 wurde die Tafel im Zuge von Bauarbeiten für eine Bahnlinie an der Südküste Israels entdeckt und anschließend 30 Jahre lang als Gehwegplatte verwendet. Erst 1943 soll ein Wissenschaftler den historischen Wert erkannt haben. Nach der Entdeckung wurde sie im jüdischen Museum in Brooklyn aufbewahrt, später von einem privaten Sammler gekauft. Im Zuge der Auktion hat ein Bieter nun 5,04 Millionen Dollar (4,85 Millionen Euro) gezahlt – weit mehr als der vorab geschätzte Erlös von bis zu 2 Millionen Dollar (etwa 1,9 Millionen Euro). Die Zehn Gebote sind auch in verschiedenen Kirchen hierzulande Teil der künstlerischen Ausstattung – so in Buldern oder Dülmen.
„Orte der Polizeigeschichte“ in Nordrhein-Westfalen

Seit dem 9. Dezember existiert eine neue Online-Präsentation, die ihm Rahmen des Forschungsprojekts „Orte der Polizeigeschichte“ entstanden ist. Hier werden relevante Orte der Polizeigeschichte in Nordrhein-Westfalen öffentlichkeitswirksam vorgestellt und zu einer didaktischen Nutzung der vorhandenen Informationen ermuntert. Im Fokus des Projekts steht die Rolle der Polizei im Kontext der Geschichte der Weimarer Republik und insbesondere des Nationalsozialismus. Zielsetzung des Projekts und der digitalen Landkarte ist die öffentlichkeitswirksame Sammlung, Systematisierung und Präsentation von relevanten Orten der Polizeigeschichte in Nordrhein-Westfalen und die Ermöglichung ihrer didaktischen Nutzung. Insgesamt wurden rund 50 Orte auf entsprechenden Lernseiten anhand von allgemeinen Informationen, Fotos, Videos, didaktischen Materialien, Flyern und Broschüren aufbereitet. Zusätzlich wurde eine interaktive NRW-Karte entwickelt, die alle Orte abbildet und gleichzeitig Verlinkungen zu den jeweiligen Seiten enthält. Das Projekt wurde von einer Forschungsgruppe des Instituts für Geschichte und Ethik der Polizei und öffentlichen Verwaltung (IGE) der HSPV NRW durchgeführt. Die Lernseiten richten sich in erster Linie an Kommissaranwärterinnen und -anwärter sowie an junge Polizistinnen und Polizisten aus NRW. „Polizisten setzen sich mit der Wirklichkeit auseinander und Polizisten haben eine ganz besondere Verantwortung für die Gesellschaft“, erläuterte Landesinnenminister Herbert Reul bei der Projektvorstellung. „Sie müssen wissen, um was es geht, und es gibt nichts Besseres als konkrete Erfahrung und konkrete Beispiele. Und die Vergangenheit bietet einfach reichlich böse Beispiele, aber Beispiele zum Lernen.“ Über den polizeiinternen Kreis hinaus soll die Projekthomepage auch die interessierte Öffentlichkeit ansprechen.
Zur Projektseite "Orte der Polizeigeschichte" >>>
Bild: Adressbuch des Kreises Coesfeld 1937, S.124
LWL-Sonderausstellung über Kirchen in der NS-Zeit

Seit dem Frühjahr 2024 präsentiert der LWL-Kulturort Kloster Dalheim bei Paderborn ein besonderes Angebot: Die Sonderausstellung „Und vergib uns unsere Schuld? Kirchen und Klöster im Nationalsozialismus“ möchte erstmals umfassend das komplexe Verhältnis der christlichen Kirchen zum Nationalsozialismus beleuchten. Die Ausstellung, die bis zum 18. Mai 2025 geht, thematisiert das Spannungsfeld zwischen Kollaboration und Widerstand und stellt das Verhalten christlicher Akteure – von einfachen Gläubigen bis hin zu Bischöfen und dem Papst – in den historischen Kontext. Die Ausstellung zeigt anhand von mehr als 200 Exponaten aus Museen und Archiven, wie der Nationalsozialismus den christlichen Glauben zu verdrängen versuchte und welche Rolle christliche Motive im Widerstand spielten. Die Schau thematisiert auch die Verstrickung von Kirchen und ihren Anhängern in die Unterdrückungs- und Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. Zentrale Themen sind die Reichskonkordats-Verhandlungen zwischen dem Vatikan und dem NS-Regime, der Gegensatz zwischen „Deutschen Christen“ und der „Bekennenden Kirche“ sowie die institutionelle Aufarbeitung der NS-Zeit durch die Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit Briefen, Tagebüchern und bislang unveröffentlichten Dokumenten aus dem Vatikanischen Archiv gibt die Ausstellung eindringliche Einblicke in das Leid der Opfer und das Handeln von Tätern, Mithelfern und Widerstandskämpfern. Übrigens: Die in Dalheim gezeigte Dauerausstellung über den Niedergang der westfälischen Klöster am Beginn des 19. Jahrhunderts im Zuge der „Säkularisation“ präsentiert als exemplarisches Einzelschicksal auch die Dülmener Augustiner-Nonne Anna Katharina Emmerick!
Digitales Findbuch zu NS-Verbrechen

Ein „digitaler Atlas“ wurde am 9. Dezember in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. Er soll im kommenden Jahr, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, die vielen Tausend Tatorte von NS-Verbrechen in Deutschland in Erinnerung rufen. Dieser Online-Atlas wird von der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ verantwortet und vom Bundesfinanzministerium mit bis zu 780.000 Euro gefördert. Die entsprechende App sei nach Auskunft von Projektleiter Wolfgang Hauck voraussichtlich ab Februar verfügbar. In dem digitalen Findbuch sind auf Landkarten rund 25.000 Fälle verzeichnet, die sich auf rund 8.000 Orte in ganz Deutschland beziehen. Grundlage ist eine von Historikern zusammen getragenen Datenbank mit Gerichtsakten zu Fällen, die nach 1945 abgeurteilt wurden. Diese Informationen würden, so Hauck gegenüber der Deutschen Presseagentur, „niedrigschwellig“ für alle Interessierten zugänglich gemacht, statt nur für Wissenschaftler in Archiven. Der Fokus liege auf jungen Leuten. Wer im eigenen Ort weiter recherchieren wolle, könne von den Projektverantwortlichen weitere Erkenntnisse anfragen. „Es ist nicht innovativ“, meint Hauck. „Es ist die Herstellung einer Selbstverständlichkeit.“ Der Anstoß zur Recherche der Fälle bundesweit sei schon vor Jahren von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem gekommen. Diese habe in Deutschland nach einer Übersicht der von Gerichten verfolgten Verbrechen gefragt, die aber zum damaligen Zeitpunkt nicht vorgelegen habe. Die Verbrechen, die der Digitalatlas zusammenstellt, lassen sich in „Tatkomplexe“ gliedern – wie beispielsweise Pogrom, Denunziationen, Verbrechen an politischen Gegnern, Endphasenverbrechen oder sogenannte Euthanasie. „Das Erschreckende an diesem Projekt ist die Bandbreite“, sagte Wolfgang Hauck.
David Dublon – jüdischer Dirigent, Kantor und Lehrer in Dülmen

Das kulturelle Leben im ländlichen Münsterland wurde im frühen 20. Jahrhundert auch von Jüdinnen und Juden geprägt. Der Heimatverein Dülmen und das Stadtarchiv haben am 19. November 2024 zu einem Vortrag mit Sharon Jael Betker eingeladen, der sich mit diesem besonderen Aspekt der Stadtgeschichte befasste.
Im Mittelpunkt des Vortrags stand das Leben von David Dublon. Der Dülmener Lehrer, Kantor und Dirigent wirkte segensreich viele Jahrzehnte in zwei lokalen Männerchören. David Dublon war jüdischen Glaubens und wohnte mit seiner Familie in der Lehrerdienstwohnung an der Synagoge in der Münsterstraße. Mit der so genannten Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland wurden jüdische Mitbürger trotz ihrer Verdienste und Erfolge aus Vereinen und Positionen im Kulturbetrieb verdrängt. Dazu reichte oftmals ein verändertes politisches Klima in der Stadtgesellschaft aus. Offene Judenfeindlichkeit, Hetze und Diffamierungen schufen auch in Dülmen eine Drohkulisse, die es den Menschen mit jüdischen Wurzeln in Dülmen schwer machte, ihr gewohntes, sozial integriertes Leben in Dülmen weiter zu führen. David Dublon ist einer von vielen Musikerbiografien, die die Referentin Sharon Jael Betker im Rahmen ihrer Masterarbeit aufgearbeitet hat. Dazu hat sie Archive gesichtet und Nachfahren befragt.
So konnte Stadtarchivar Dr. Stefan Sudmann zum Ende des Vortrags resümieren, dass einige Archivstücke und Informationen für ihn neu waren und das soll bei Sudmann als ausgewiesenem Stadthistoriker schon etwas heißen.
Das Publikum bedankte sich mit kräftigem Applaus.
Text: Erik Potthoff
Unter Flüchtlingen: Interessantes Dokument zu Friedrich Kaiser

Am 25. März 1939 verließ der aus Dülmen stammende Herz-Jesu-Missionar Friedrich Kaiser (1903-1993) von Bremerhaven aus seine Heimat, um an seine neue Wirkstätte zu gelangen – nach Peru. Im Archiv der Schiffs-Reederei „Norddeutscher Lloyd“ in Bremen hat sich bis heute die originale „Ausreiseliste“ >>> erhalten, die auch ein Schlaglicht auf die damalige Situation der deutschen Juden wirft: In der Tabelle sind sämtliche 17 Passagiere eingetragen, die mit dem Frachtschiff „Isar“ die Ausreise nach Südamerika (mit den Zielen Ecuador, Chile, Bolivien und Peru) antraten. Von diesen 17 Personen waren sechs Fahrgäste Juden und drei „Mischlinge“, die in letzter Minute die Chance zur Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland nutzten. 14 Passagiere waren als „Auswanderer“ notiert, 3 als „Reisende“ – darunter der „Missionspriester“ Friedrich Kaiser, der damit seine Überfahrt quasi als „vorübergehend“ deklarierte; andernfalls war eine hohe „Reichsfluchtsteuer“ an den deutschen Fiskus zu entrichten. – Wir danken Herrn Holger Bischoff, dem Archivar des IHK für Bremen und Bremerhaven, für den Hinweis auf dieses Dokument!
Foto: Schiff ISAR; Historisches MarineArchiv, Urs Heßling
Symbolik des Alten Testaments verschwunden

Ein markantes Sinnbild aus dem alttestamentlichen Buch Genesis war lange Zeit Vorlage für das offizielle Loge der Dülmener Heilig-Geist-Stiftung; in diesem Sommer wurde es durch ein neues Logo ersetzt und damit abgeschafft: Eine kreisrunde gelbe Scheibe symbolisierte den Kosmos; zwei geschwungene Wellen standen für das Schweben des Geistes Gottes über den Wassern. Die stilisierte Skizze nahm Bezug zum alttestamentlichen Schöpfungsbericht, wo es schon im zweiten Vers der Bibel heißt: „Die Erde war wüst und leer, Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.“ (Gen 1,2) Zwar wird das hebräische (feminine) Wort „ruach“ in der Regel mit „Geist“ übersetzt, die wörtliche Bedeutung ist allerdings „bewegte Luft“, die mit dem Handeln Gottes in Verbindung gebracht wird.
Erst im Herbst 2021 hatte der Dülmener Künstler Fritz Pietz für den Gemeinschaftsraum des Altenwohnheims am Dülmener Mühlenweg ein Wandrelief des Dülmener Heilig-Geist-Logos erstellt. Damals wurden von den Bewohnerinnen und Bewohnern rd. 150 gelbe Plättchen gestaltet, die Fritz Pietz zur gelben Scheibe unter den so markanten kräftigen schwarzen Linienzusammenfügte: Wie unter einen beschwingten Schutz versammelten sich quasi die vielen Einzelnen unter dem Wirken des Geistes. „Gegenüber einem überzogenen Anspruch an individuelle Selbstbestimmung oder menschliche Professionalität versteht sich das Vertrauen auf den Geist Gottes immer auch als ein Appell, mit Gelassenheit und Gottvertrauen das Miteinander zu denken und zu gestalten“, findet Pfarrer Markus Trautmann, der den Abschied vom Geist-Logo bedauert. Der Bezug zur „ruach Gottes“, so Trautmann, drücke den Respekt vor dem „großen Ganzen“ aus sowie die Offenheit für eine Dynamik und Kraft, die der Mensch nicht selbst „machen“ soll, sondern sich auch schenken lassen darf.
Foto Fritz Pietz: Reimund Menninghaus
Entscheidung zur Detmolder Hofsynagoge

In dem jahrelangen Rechtsstreit um den geplanten Abriss eines früheren Synagogengebäudes in Detmold aus dem 17. Jahrhundert hat das Oberverwaltungsgericht Münster am 19. September ein Urteil gefällt, nach dem der Denkmalschutz des Gebäudes vom Eigentümer zu respektieren sei. Wir veröffentlichen nachstehend den Pressetext des Oberverwaltungsgerichts:
Der Eigentümer eines denkmalgeschützten Gebäudes in Detmold, das laut Denkmaleintragung im 17. Jahrhundert als jüdischer Betsaal errichtet worden ist, kann keine Genehmigung für dessen Beseitigung beanspruchen. Das hat das Oberverwaltungsgericht heute nach mündlicher Verhandlung entschieden.
Das seit Ende der 1980er Jahre unbewohnte Gebäude wurde 1988 als Beispiel eines innerstädtischen Gartenhauses in die Denkmalliste der Stadt Detmold eingetragen. Nachdem die seinerzeitige Eigentümerin im Jahr 2010 einen Antrag auf Abbruch des Baudenkmals gestellt hatte, fanden Untersuchungen zur Geschichte des Gebäudes statt. Diese führten 2011 zur Erweiterung der Denkmaleintragung dahingehend, das Gebäude sei 1633 als jüdischer Betsaal errichtet worden. 2018 versagte die Stadt die Genehmigung zum Abriss des Baudenkmals. Daraufhin klagte der Kläger, der zwischenzeitlich Grundstückseigentümer geworden war, auf Erteilung der Genehmigung, blieb damit aber beim Verwaltungsgericht Minden erfolglos. Zur Begründung seiner Berufung machte er geltend, der historische Sachverhalt sei durch das Verwaltungsgericht nicht ausreichend aufgeklärt worden, es habe sich gar nicht um ein jüdisches Gebetshaus gehandelt. Außerdem sei die Rettung des abgängigen Gebäudes nur als Kopie möglich und ihm zudem wirtschaftlich unzumutbar; er wolle dort stattdessen Parkplätze errichten. Die Berufung hatte keinen Erfolg.
Die Vorsitzende des 10. Senats des Oberverwaltungsgerichts führte in der mündlichen Urteilsbegründung aus: Der Kläger hat keinen Anspruch auf die Erteilung einer Abrissgenehmigung, weil Belange des Denkmalschutzes der Beseitigung des Gebäudes entgegenstehen. Dass es sich dabei um ein Baudenkmal handelt, ergibt sich aus der bestandskräftigen Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Detmold. Danach ist es 1633 als jüdischer Betsaal des Typs der freistehenden Hofsynagoge errichtet worden und war 110 Jahre lang der Mittelpunkt jüdischen Lebens in der Stadt, ehe es später, nach einem Umbau Mitte des 19. Jahrhunderts, als Zweifamilienhaus einfachen Zuschnitts genutzt wurde. Entgegen der Auffassung des Klägers ist nicht erneut zu prüfen, ob die denkmalfachlichen Einschätzungen zur Baugeschichte tragfähig sind und die Denkmalwertbegründung 2011 zu Recht erweitert wurde. Die damals dagegen erhobene Klage ist rechtskräftig abgewiesen worden.
Die Erhaltung des Baudenkmals ist noch möglich. Es ist nicht davon auszugehen, dass die erforderlichen Erhaltungsarbeiten dazu führen, dass die Identität des Denkmals und damit seine Denkmalaussage beseitigt werden. Der Kläger kann sich auch nicht darauf berufen, dass ihm die Erhaltung des Denkmals wirtschaftlich unzumutbar ist. Denn er hat die Unverkäuflichkeit des Denkmals nicht nachgewiesen. Er hat sich nicht hinreichend bemüht, das Denkmal zu einem angemessenen Preis an die Stadt Detmold zu verkaufen, die zur Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt ernsthaft am Kauf interessiert ist und diesen wiederholt und über Jahre angeboten hat. Der Kläger hat sich dem bis heute verweigert. In der heutigen mündlichen Verhandlung hat die Stadt ihm förmlich die Übernahme des Denkmals angeboten. Ein sonstiges schützenswertes Interesse des Klägers an einer - durch Anforderungen des Denkmalschutzes unbelasteten - Nutzung des Grundstücks, das die Beseitigung rechtfertigte, ist nicht zu erkennen. Das geltend gemachte Interesse an der Schaffung von zwei bis drei Parkplätzen an der Stelle des Gebäudes muss gegenüber den Belangen des Denkmalschutzes zurückstehen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Stadt Detmold >>>
Fotos: Von Tsungam - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82618412